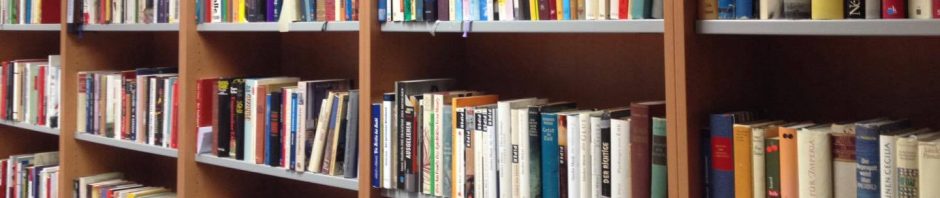Über den Autor
Béla Zsolt wird 1895 in Großwardein (Nagyvárad, heute Rumänien) in einer großbürgerlichen jüdischen Familie geboren. Vier Jahre wird er im 1. Weltkrieg eingezogen, dann, 1920, übersiedelt Zsolt nach Budapest, wo er schnell ein bekannter Publizist wird, dessen Leben sich hauptsächlich im Kaffeehaus abspielt. Er leitet die Zeitschrift „Toll“ („Die Feder“), attackiert in seinen Artikeln in scharfem Ton Rechte und Linke, die aristokratischen Reaktionäre und Romantiker des Landlebens. Er ist ein Verfechter liberal-bürgerlicher Tradition und Werte. Den 2. Weltkrieg erlebt der Autor an der Ostfront als Zwangsarbeiter in ukrainischer Kriegsgefangenschaft, im Gefängnis in Budapest und später im Ghetto in Großwardein. Dass er nicht wie die meisten Juden in Ungarn im Gas umkommt, verdankt er der „Kasztner-Aktion“, die in letzter Minute 1500 ungarische Juden freikauft, unter andern auch ihn und seine Frau. Bis 1945 müssen sie noch in Bergen-Belsen ausharren, bis sie schließlich in die Schweiz emigrieren können. Gleich nach dem Krieg nimmt Zsolt seine politische und literarische Aktivität wieder auf, kehrt nach Budapest zurück: Er gründet die Partei der „bürgerlichen Demokraten“, wird 1947 ins Parlament gewählt. In der Zeitschrift „Fortschritt“ kämpft er gegen Korruption, den schon wieder auflebenden Antisemitismus und gegen die mächtiger werdende kommunistische Partei. Als Zsolt schon todkrank ist, schreibt er in der Zeitschrift „Fortschritt“ jede Woche eine Fortsetzung seiner Erinnerungen an die Zwangsarbeit und das Ghetto. Diese erscheinen als Buch erstmalig posthum 1980 in Ungarn unter dem Titel „kilenc koffer“ – „Neun Koffer“. Béla Zsolt stirbt 1949 in Budapest.
In der ‚Ehinger Bibliothek‘ befindliche Publikationen:
- Neun Koffer. Originaltitel: Kilenc koffer. Übersetzung von Angelika Máté. Neue Kritik, 1999. ISBN 3-8015-0335-6
- Eine seltsame Ehe. Originaltitel: A Dunaparti nö. Übersetzung von Angelika Máté. Neue Kritik, 2001. ISBN 3-8015-355-0