Novellen
Aus dem Ungarischen von Gabriel Maria Trischler
Verlag: tredition , 2018, 153 Seiten
ISBN: 978-3-7469-2557-8
Originaltitel: Fortuna szekerén. Válogatott elbeszélések 1965-2015, 2015
Bezug: direkt beim Verlag: https://tredition.de/buchshop/ oder Buchhandel; Preis: 7,99 Euro
von Gudrun Brzoska
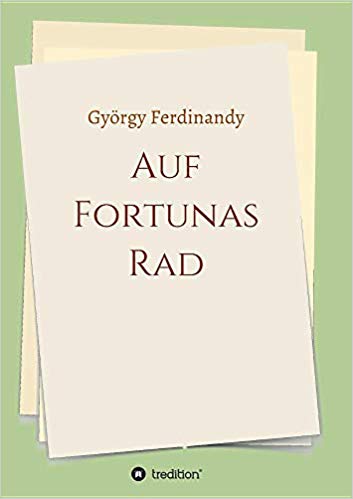
Der Tenor dieser neun Erzählungen, die zusammen einen autobiografischen Roman ergeben, ist das Nicht-Ankommen in der Fremde, ebenso die fast unmögliche Rückkehr eines Exilanten: Nicht nur seine eigene Geschichte, sondern auch die Geschichte seiner Heimat hat sich weiterentwickelt. An seine früheren Erfahrungen kann er nicht anknüpfen, obgleich er die äußeren Umstände wieder erkennt.
„In solch einer Situation begreift man, dass es keinen Rückweg gibt. Dass alles das Ergebnis persönlicher Entscheidungen ist und kein Schicksalsschlag. Und die Träumereien überflüssig sind.“
Es ist die Lebensgeschichte des Hochschullehrers György oder Georges (auf Französisch) Ferdinandy. Der Autor entwickelt chronologisch seinen Werdegang, von dem Augenblick an, als er nach dreijähriger Haft (?- oder Militärdienst?) entlassen wird und in sein altes Leben wieder eintauchen möchte. Schon in diesen drei Jahren (1953-56) hatte sich in Ungarn einiges verändert, das sagt ihm seine Mutter: Meinungsäußerungen werden nicht mehr so scharf sanktioniert – aber man muss darauf achten, was man sagt. Auch äußerlich hat sich einiges verändert. Aus einer späteren Erzählung erfahren wir, dass die Familie der oberen Bürgerschicht angehörend (der Großvater war Arzt), aufs Land nach Gödöllő ausgesiedelt worden war. Inzwischen durfte sie wieder zurückkehren, und nun leben Mutter und zwei Geschwister in ihrer ehemaligen Garage, die zu einer Zwei-Raum-Behausung umgebaut wurde, ohne Wasserleitungen. Der Vater, halb gelähmt und schwerkrank, verbringt seine Tage in einem Heim. Yuri, der junge Mann, hat aber Glück: Er darf seine frühere Arbeit als Straßenbahnschaffner wieder aufnehmen und er wird endlich, wie er es drei Jahre zuvor bereits versucht hatte, in die romanistische Fakultät der Universität aufgenommen. Das Glück dauert aber nicht lange: Es ist – im wahrsten Sinne des Wortes – der Vorabend der Ungarischen Revolution von 1956.
Der Aufstand wird niedergeschlagen, und Yuri muss fliehen, um nicht wieder eingesperrt zu werden.
Es gelingt ihm über Österreich nach Frankreich, ins Elsass zu gelangen, wo die geflüchteten Studenten in einem alten Schloss einquartiert werden. Der Stress des Exils beginnt nur allzu schnell: Einige wollen zurück. Er selbst trifft es nicht schlecht, er lernt eine junge Frau kennen, die er bald heiratet. Die fremde Gesellschaft hatte ihn scheinbar aufgenommen. Rückblickend habe er wie in einem Wachtraum gelebt, schreibt er später, zwischen Heimweh, dem Festhalten an seinen Erinnerungen und dem Leben im Jetzt der Wirklichkeit.
Als nach sechs bis sieben Jahren eine Amnestie für die Flüchtlinge verkündet wurde, tangiert ihn das nicht: „Eine Amnestie zu verkünden ist ein Brauch, den man erst dann praktiziert, wenn die Menschen durch das Warten schon gebrochen (zermürbt) waren. Wenn das Urteil an den Verurteilten vollzogen worden war.“ Nach so vielen Jahren kehrt kaum noch einer zurück. Man hat sich in der neuen Umgebung eingerichtet. Er hätte davon gar nicht erfahren, wenn ihm nicht seine Mutter geschrieben und ihren Besuch angekündigt hätte. Nicht nur aus seinem Heimatland hatte er sich vertrieben gefühlt, sondern auch von seiner Mutter, die nicht ein einziges Mal einen seiner Briefe beantwortet hatte. Nun kommt sie mit großen Erwartungen, die darauf hinauslaufen, er solle zurückkommen und ein Haus für die Familie bauen. Sarkastisch beschreibt Ferdinandy, wie es ihnen in Paris ergangen war, bei einem ehemaligen General, dessen Sohn der Großvater ärztlich behandelt hatte: Zum Abschied drückte man ihnen, den armen Flüchtlingen, den obligatorischen Sack mit Altkleidern in die Hand.
Yuri bleibt in Frankreich, obwohl er zu dieser Zeit bereits getrennt von Frau und Kind lebt. Wie aus einer späteren Erzählung hervorgeht, hatte er der betuchten Bürgerstochter nichts „Exotisches“ zu bieten. Stattdessen muss er Geld verdienen. Überdies ist er wohl oft melancholisch und von Heimweh geplagt. Sein Studium kann er noch lange nicht wieder aufnehmen, er muss Geld verdienen als Fliegender Händler, als Bauarbeiter, in den Pariser Markthallten, bis er weiterstudieren, promovieren und schließlich als Professor 36 Jahre lang an der Universität von Puerto Rico lehren darf. Seine in der Heimat zurückgebliebenen Kommilitonen waren mit ihren Studien 13 Jahre früher fertig….
Immer wieder kommt Ferdinandy darauf zurück, wie unmöglich es ist, wirklich Fuß zu fassen in einem fremden Land – und wie schwer die Rückkehr in die einstige Heimat ist.
Ferdinandy beschreibt in diesen Erzählungen nicht nur seine eigene Geschichte, sondern auch ausführlich die Schicksale anderer „Fremder“, die sie immer geblieben sind, egal wie lange sie schon in einem Land lebten. Er lässt Begegnungen einfließen, die er gemacht hat, streift flüchtig aber nachdrücklich die Situationen der Bekannten.
Bilanz zieht er in den letzten Kapiteln, als er den endgültigen Umzug in seine Heimat bereits gewagt hat. „Wer hätte gedacht, dass dieser lange dunkle Tunnel auch mal ein Ende haben würde“: Über seinen Erinnerungsstücken, die ihn bisher überallhin begleitet hatten, lässt er sein Leben Revue passieren: Was bleibt von ihm, seinen „Abenteuern“ und Begegnungen? Sooft hat er Orte und Berufe gewechselt, zweimal waren seine Ehen gescheitert.
Trotzdem war es ihm nie in den Sinn gekommen, sich für immer in den Tropen einzurichten. „Ständig bereitete ich mich auf die Heimkehr vor, in die Alte Welt, ungarische Bücher schrieb ich während meiner sechsunddreißig Tropenjahren“.
Eigentlich wäre es normal gewesen, zu bleiben, seine Bücher wurden ins Spanische übersetzt, hier starben auch Schicksalskameraden, denen es nicht eingefallen war, das freundliche warme Land zu verlassen.
Zurück in der alten Heimat, erlebt er seine größte Überraschung: Seine Söhne kehren auf die Insel zurück und leben auch heute noch dort. Dort ist ihre Heimat.
Er ist alleine geblieben, mitten in der Welt. Die Heimat hatte ihn nicht verlassen, sie hatte ihn fest umschlungen: „Glücklich, unglücklich, das ist meine Heimat.“
Sarkastisch beschreibt er die Farce um die Aufenthaltserlaubnis seiner zweiten Frau in Ungarn, einer gebürtigen Kubanerin, die als 10jähriges Kind hatte nach Florida fliehen müssen.
Seine eigene Migrantengeschichte und die seiner Frau wird er den Daheimgebliebenen nicht erzählen. Für diese sind sie die „reichen Amerikaner“. Dass sie in strömendem Regen und bei Kälte hatten schuften müssen, würden sie nicht glauben.
Er aber erinnert sich, schreibt seine Erlebnisse und Überlegungen auf. Mit der aktuellen Politik kennt er sich nicht aus, aber er weiß, im Gegensatz zu den sogenannten bürgerlichen Kreisen, „dass wir auf Heimatlose, die in diesen Tagen die Grenzen übertreten, nie würden schießen lassen.“
Die neun Kapitel scheinen mir eine Sammlung aus verschiedenen Novellen diverser Bücher zu sein, die auf Französisch und auf Ungarisch erschienen sind. Daher fehlt manchmal eine Überleitung, die dem Leser den Überblick etwas erleichtern würden.
Die Erzählungen sind spannend – und wohl ironisch-prägnant geschrieben, in einer modernen, zupackenden Sprache – wenn man ungarischen Kritiken glauben möchte. Als deutsche Leserin kann ich über die literarische Qualität leider nicht viel sagen, denn der Originaltext aus dem Ungarischen ist denkbar schlecht übersetzt. Es wimmelt nicht nur von sinnentstellenden Übersetzungsfehlern. Schade! Das hat ein Mann, der einige bedeutende Literaturauszeichnungen in Frankreich und Ungarn erhalten hat, nicht verdient.
Trotzdem möchte ich das Buch empfehlen; denn es ist gerade in unserer Zeit ein wichtiger Beitrag zur gegenwärtigen Situation von Ankommen und/oder Gehen. Außerdem würde ich es sehr begrüßen, wenn Ferdinandy uns mit guten Übersetzungen auch in Deutschland bald vorgestellt werden würde.

