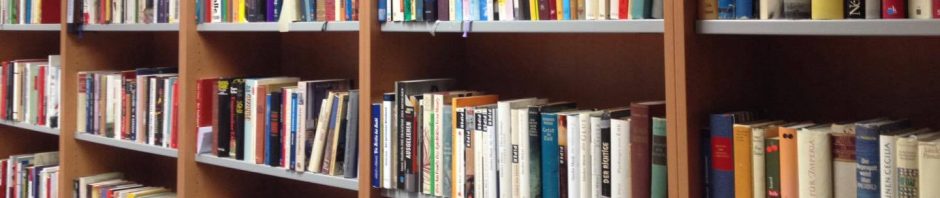![]() – textkörper –
– textkörper –
Aus dem Ungarischen von György Buda
Verlag: Nischen Verlag Budapest & Wien, 2013
ISBN: 978-3-9503345-5-5
Originaltitel: Pixel, 2011
Bezug: Preis: 19,80 Euro
Die Autorin komponiert aus 30 Körperteilen einen „Textkörper“, der aber nicht endgültig da steht, sondern sich ständig verändert, je nachdem, welche Wendung sie der Erzählung gibt. Sie probiert aus, zeigt verschiedene Wege auf, welche das Schicksal nehmen könnte – die Figuren haben eine Eigendynamik – aber die unbarmherzige Erzählerin im Hintergrund sieht ihnen kühl und reserviert zu, wie sie sich verheddern in ihren Lebensgeschichten. Hilfe bekommen sie keine.
Vielleicht kommt man dem gesamten Erzählband näher, wenn man alles so betrachtet, wie in Kapitel 28 „Die Geschichte des Knies“ beschrieben. Dort will ein Fotograf eine Ansammlung von ausgetrockneten Teefiltern als Gesamtbild fotografieren. Über Jahre ist das Werk entstanden, in seiner Fantasie hatte er schon immer das fertige Bild im Kopf, jahrzehntelang die einzelnen Details gesammelt und fotografiert. „Aus der Nähe sieht man bloß Pixel, ausgetrocknete Teebeutel, aus einer Entfernung aber wächst alles das zu einem einzigen Körper zusammen.“
Wenn man sich als Leser am Ende des Buches dieses Bild vergegenwärtigt, dann entstehen in der Gesamtschau der einzelnen Geschichten, die eben wie Pixel wahllos und scheinbar zufällig aus unterschiedlichen Alltagsgeschichten herangezogen wurden, ein Zusammenhang, fast eine einzige Geschichte. Die Autorin erzählt nicht chronologisch, auch die einzelnen Körperteile folgen keinem System von oben nach unten – man muss sich schon durcharbeiten durch Kopf und Knie, Mund, Hals, Ohren, Fuß, Zähne Gaumen usw.. Aus scheinbar zufälligen Begebenheiten wächst ein Ganzes zusammen, alles steht miteinander in Verbindung. Die Fäden laufen hin und her, auch wenn die Protagonisten der einzelnen Erzählungen nichts voneinander wissen, verändern Kleinigkeiten das Gesamtbild. So wie die berühmte Geschichte vom Schmetterling, der mit einem einzigen Flügelschlag die ganze Welt verändern kann.
Nur, dass die Geschichten derart pessimistisch und sarkastisch, zum Teil ironisch-zynisch sein müssen, will mir nicht in den Kopf. Das Schicksal sucht sich doch nicht immer die schlimmste Variante aus! Die Autorin erzählt seltsam monoton und unterkühlt, distanziert und leidenschaftslos: Das Leben ist banal – mag es auch noch so vielversprechend beginnen. …“Als das Schicksal, noch ein letztes Mal, mehrere mögliche Geschichten angeboten hatte …. Und die Wirklichkeit zeigte auf die allerschlimmste[Geschichte]; sei’s drum, wir wollen weiterkommen, entscheiden wir uns für diese hier. Immer ist es die schlimmste Geschichte, die zur Gegenwart wird, und das ist immer erst nachträglich zu sehen“. Es gibt kein Ende, welches sich noch zum Guten wenden könnte. Es gibt Sehnsüchte, ja, aber dem Leser bleibt eine gedachte Fortsetzung „im Halse stecken“ – so weit er auch umherblickt, ist alles hoffnungslos – ohne Erlösung und Glück. Und das nicht nur in Ungarn. Krisztina Tóth nimmt uns mit nach Treblinka, nach Ulm, nach Bukarest, an den Strand, nach Paris, auf den Balkan und anderswo hin. Meist geht es um wenig geglücktes Leben, verunglückte Beziehungen, um Geschiedene, einsame Singles, Gescheiterte, um Ehebruch, Treulosigkeit und Verrat, um Missverständnis und Rache – um sogenannte Alltagsgeschichten eben.
Die Figuren strahlen oft keine eigene Individualität aus, sie stehen für viele …“nennen wir sie Norma“ damit wenigstens einmal eine einen Namen hat. Und wenn wir auch immer wieder den gleichen Personen in Tóths Geschichten begegnen, aus anderer Sicht, aus anderer Zeit erzählt, so erleichtert das lediglich die Zuordnung. Eigentlich sind sie „die Alte“ – „der Alte“, „die Junge“ – „der Junge“; skurill und naiv, böse, zynisch, ironisch und hoffnungslos.
Man wird leicht deprimiert und depressiv beim Lesen der Schicksale – und hat das dringende Bedürfnis, mit etwas Schönem, Erfreulichem wieder etwas Hoffnung ins Leben sickern zu lassen – und sich damit dem niederdrückenden Sog zu entziehen.
Ja, einen Sog entfalten die Geschichten schon, man kann das Buch kaum aus der Hand legen – wie geht es weiter – kommt doch einmal ein gutes Ende?
Gleich zu Anfang begegnen wir einem kleinen Jungen mit einer gepolsterten Kinderhand. Er zeichnet Kreise auf eine Tischplatte. Anrührend – Er stirbt in Treblinka. „Nein“, gibt die Erzählerin der Geschichte eine andere Wendung, es ist ein Mädchen aus Litauen, oder doch Gavriela aus Saloniki?
Dann treffen wir eine Ärztin, die als junge Frau, zum ersten Mal im Westen, sich auf einer Vortragsreise mit ihrem Oberarzt einlässt. Wir werden ihr noch öfter begegnen Ihr Mann ist Fußballfan – eine Tochter wird später nach Deutschland heiraten. Jahre später, sie ist inzwischen geschieden, kann sie ihrem Patienten nicht mitteilen, dass er einen Hirntumor hat. Stattdessen verbringt sie eine Nacht mit ihm. Auch dieser Patient taucht öfter auf, namenlos. Er hat eine Geliebte, er hat eine Familie.
In einer anderen Erzählung geht die Fantasie mit der Erzählerin durch: In der U-Bahn sieht sie eine Frau mit dunkler Brille und weißen Stock, gut zurecht gemacht. Sie trägt sogar eine Uhr. Sogleich fallen ihr allerhand Geschichten dazu ein, immer aufs Schlimmste gefasst: Ein Unfall? Eine Augenkrankheit? Wie ist ihr familiärer Hintergrund? Sicher auch niederschmetternd. Und als die Frau schließlich aufsteht und geht – ist sie nicht blind, sondern hat nur eine weiße Vorhangstange in der Hand. Da schlägt das Mitgefühl der Erzählerin in Gereiztheit um. Sie ist nicht zufrieden damit, dass die Frau gar nicht blind ist – sie muss ihr ein anderes Schicksal andichten: Die Uhr ist ein billiges Mitbringsel ihrer Tochter Helga aus Griechenland, welche ihre Mutter hasst.
Eine rothaarige Lehrerin taucht auch ein paar Mal auf. Im Lauf der vierten Erzählung (Die Geschichte der Füße) sieht sie u.a. einen Romajungen mit einer Krücke. Dieser Junge begegnet uns wieder in der 26. Geschichte (Die Geschichte des Rückens). Wir erfahren von der Lehrerin, dass sie als 19jährige ein Mädchen geboren hat. Es hatte das Down-Syndrom und die junge Mutter, schrecklich allein, von ihren Eltern zurückgewiesen, gibt das Kind weg. Sie kann es nicht vergessen. Immer, wenn sie eine junge Frau mit Down-Syndrom sieht, muss sie an ihre Tochter denken, von der niemand weiß, auch nicht ihr Mann.
Dann lernen wir noch Misi kennen, einen kleinen pummeligen Jungen, der Angst hat vor Hunden, der einen Senkfuß hat, dessen Eltern geschieden sind und dessen Vater Busfahrer ist. Jahre später wird er Kontrolleur im Busbetrieb, legt den Beruf nieder und verdingt sich als Sicherheitsmann einer Firma. Dort trifft er auf den Bruder des Romajungen. Die Geschichte geht natürlich schlecht aus – für alle Beteiligten.
Das alles aber erfährt der Leser nur bruchstückhaft – über mehrere Kapitel verteilt. Genau das macht aber auch die Spannung und den Sog des Buches aus, dass man immer weiter und weiter lesen muss, um sich zu erinnern und den Faden nicht zu verlieren. Alles ist miteinander verwoben, ohne dass die Betreffenden davon wissen. Namen und Jahrszahlen werden nur genannt, um die Authentizität der Geschichte zu belegen, doch die Figuren sind auswechselbar, so wie ihre Schicksale.
Trotz aller Mühen, die sie dem Leser abverlangen, sind das lesenswerte Geschichten, in ihrer Lakonie, in denen jede Wendung herausgemeißelt zu sein scheint. Vielleicht kommt dabei Tóths Ausbildung zur Bildhauerin zum Tragen.
Noch ein Wort zur Übersetzung: Es ist schön, dass György Buda in österreichisches Deutsch übersetzt hat. Auf diese Weise wird das ungarische Idiom, der Klang, die Farben der Erzählungen besser unterstrichen.