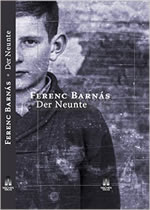 Der Neunte
Der Neunte
Roman
Aus dem Ungarischen von Eva Zador
Verlag Nischen, Wien 2015
ISBN: 978-3-9503906-0-5
Originaltitel: A kilencedik, 2006
Bezug: Buchhandel, Preis: 21,00 €
Im Traum ist er mutig, da nimmt er es sogar mit seinem Peiniger Perec auf und erledigt ihn einfach. Er, der Erzähler, ist das neunte von elf Kindern einer bitterarmen Familie in Ungarn. Nach dem Krieg wurde sein Vater aus der Volksarmee entlassen, weil er sich weigerte der Partei beizutreten. Daraufhin war er gezwungen, einen Beruf nach dem anderen zu lernen. Den „Roten“ wollte er es zeigen. Und so kam er auf den Gedanken, heimlich Rosenkränze zu fabrizieren und später auch Heiligenbilder zu vermarkten. Im Jahr 1968, während der Kádár-Diktatur, ist die Familie gerade dabei, mit Hilfe eines Darlehens ein größeres Haus zu bauen. Vor zweieinhalb Jahren waren sie aus Debrecen nach Pomáz, nahe Budapest, gezogen und leben seit-her in einer Einzimmerwohnung auf 20 Quadratmetern. Nur die älteste Schwester, Klara, war dort geblieben weil sie geheiratet hatte.
Der neunjährige Erzähler, behindert von Sprachproblemen und einer Handverletzung, der nur zweimal bei seinem Spitznamen gerufen wird – liebevoll von seiner Schwester „Struwwelchen“ – oder im Zorn vom Bruder „Blauer!“ – ist die Stimme seiner Familie. Er macht sich über alles Gedanken, was er sieht und erfährt, spontan, ungeordnet. Es ist eine einfache, klare, aber nicht kindliche Stimme, welche da Wahrheiten aufdeckt und ausspricht: die bedrückende Armut, die sie zu Außenseitern macht, die übergroße Nähe auf den zusammengestellten Betten, gleichzeitig die körperliche Distanz, ja Prüderie der Eltern und über allem der Zusammenhalt in der Familie.
Die Mutter hatte eigentlich Pianistin werden wollen, dann Nonne, bis sie den Vater kennen lernte, der damals Offizier war. Seine Offiziersallüren hat er beibehalten und kommandiert nicht nur die Familie, sondern auch Nachbarn, Arbeitskameraden und alle Welt schneidig herum. Ausnahmen macht er nur, wenn er „Staatsleute“ vor sich hat. Von seinen Kindern verlangt er, dass sie arbeiten sollen wie er: „Ich glaube, in erster Linie stört ihn, dass wir liegen, und dann erst, dass wir nicht arbeiten. In seinem Kopf vermischen sich die beiden Sachen vermutlich, deshalb schreit er wohl an einem Tag das >Es-ist-ungesund-so-viel-zu-schlafen< und am anderen Tag das >Solang-ihr-rumliegt-soll–ich-mich-abrackern Die Mutter scheint nur dann richtig lebendig zu werden, wenn sie in der Kirche ist und Harmonium spielt.
Ihre Armut ist nicht nur existenzbedrohend, sie ist eine Katastrophe für den Erzähler, der alles daransetzt, niemanden merken zu lassen, welche Zustände zu Hause herrschen. Und trotzdem, Kind, das er ist und nichts anderes kennt, nimmt er hin, was kommt, das herrische Wesen des Vaters, die Schläge, die Marotten seiner Geschwister, das Mobbing durch die Schulkameraden, die in ihm das wehrlose Opfer spüren. Wehren tut er sich nur im Traum. Tagträume hat er nicht. Dafür ist keine Zeit – da muss der Alltag bewältigt werden: Die Kälte im Haus, wenn kein Geld da ist für Kohlen, das unregelmäßige Essen, der ständige Hunger, der ihn in die Metzgerei und ins Café treibt, nur um sich dort Wurst oder Kuchen anzuschauen, der Blick in die Fenster anderer Leute: „Im Allgemeinen gefällt mir am besten, dass es überall sauber ist und dass es richtige elektrische Lampen gibt“. Die vielen Gedanken, die er sich über alles machen muss. Erklärt wird nichts, die Kinder haben zu gehorchen.
Er erzählt von seiner Familie, porträtiert seine Geschwister, berichtet nüchtern vom Schulalltag, beobachtet seine Mitschüler, schätzt ihre Schwächen und Stärken ein, er erzählt von Frau Véra, seiner Lieblingslehrerin, die ihm wohlgesonnen ist – und auch mal mit der Hand über den Kopf streicht. Gleichmütig kommentiert er seine Schwierigkeiten beim Lesen und Sprechen, vor allem wenn er Hunger hat: „Eigentlich denke ich um diese Zeit schon an das Pausenbrot, es fällt mir auch dann ein, wenn ich es gar nicht will, und so muss ich mich schon damit beschäftigen, was wir heute wohl als Pausenbrot bekommen. Davon hängt ab, wie viele ihren Teil auf dem Tablett liegen lassen. …“
Dem Bau des größeren Hauses wird alles geopfert: Geld für regelmäßiges Essen, für Kleidung. Dafür müssen alle in der Familie Opfer bringen: Die Mutter und die Schwestern, die ihr ganzes Geld abgeben müssen, der Vater, der alles daran setzt, mit den Kindern im Akkord Rosenkränze zu fabrizieren. Es ist ein Kampf ums Überleben, ein Kampf um aus der quälend-zähen Armut heraus zu kommen, die an ihnen klebt. In der Schule würde der Neunte gern erzählen, dass sie den Bau des großen Hauses fortsetzen, doch er spricht mit niemandem.
Mit seinen kleineren Geschwistern bekommt er immer mal wieder Gelegenheit bei Beerdigungen zu ministrieren. Von dem verdienten Geld kauft er sich etwas zu essen: Wurst und Brot.
Als sie endlich ins neue Haus einziehen können, kommt es ganz anders, als erträumt. Jeder hat nun sein eigenes Bett, aber: „Ich habe so lange auf diesen Abend gewartet, dass ich jetzt am Ende unfähig bin, ihn richtig zu erleben. – … und doch, von meinem eigenen Bett hatte ich gedacht, ich würde mich darin so freuen, wie ich das in den vergangenen Monaten geplant hatte. Es scheint, wir müssen einen Zustand, wenn wir nicht in ihn hineingeboren werden, erst extra erlenen.“
Als der Vater dann die Idee hat, auch noch Heiligenbilder zu vervielfältigen, wird der Familie das Bad weggenommen, das wird seine Dunkelkammer. In genauer Terminplanung müssen selbst die Kleinen schon vor der Schule Heiligenbilder kolorieren, oft auch noch abends bis neun oder zehn Uhr. Alles Geld wird in Material gesteckt – und als ein früher Winter mit großer Kälte kommt, muss die Mutter ihr Harmonium verkaufen – für Kohlen.
In dieser Zeit begeht der Neunte einen Vertrauensbruch. Ausgerechnet gegenüber seiner Lieblingslehrerin. Auslöser war die bestürzende Erkenntnis, dass er aus einer Kleidersammlung den Pullover eines Mitschülers bekommen hat – und dieser es bemerkt hat. Danach gehen ihm ohne Übergang tausendundein Gedanke durch den Kopf: – sein ganzes Leben – die Eltern – die Mitschüler – die Geschwister – die Sachen, die sie aus der Sammlung kriegen – der Pullover, den er weggeschmissen hat – das erste Mal, als die Jungs ihn quälten – morgen wird er in der Messe ministrieren
Die beiden liebsten Menschen hat er enttäuscht, seine Mutter, die ihm nun wie eine Fremde vorkommt und die Lehrerin, die er immer noch liebt.
Ein großartiges kunstvolles Buch, das wieder einmal (nach Borbély, Die Mittellosen und Tóth, Aquarium) das elende im ungarischen Kommunismus totgeschwiegene Leben beschreibt. Es hält den Leser gefangen, bis zur letzten Seite. Es ist die nüchterne klare Sprache, die genaue und unbefangene Beobachtung, die Situationskomik, die Schwächen, seine eigenen und die seiner Umwelt, die der neunjährige Junge aufspießt und die den Leser weitertreibt, nicht etwa umwerfende Ereignisse. Es ist der Blick in die Seele eines alten Kindes, welches in seinen jungen Jahren schon so viel hat durchstehen müssen und das alles fast ohne Rebellion, aber auch ohne sich entmutigen zu lassen, über sich ergehen lässt und als er schuldig wird, auch zum ersten Mal in seine eigene Seele blickt.

