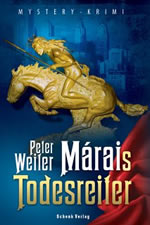 Kriminalroman
Kriminalroman
Aus dem Ungarischen von P. Dietlinde Draskóczy
Verlag: Schenk, 2010 ISBN: 978-3-939337-77-5
Originaltitel: A Márai-véletlen
Bezug: Buchhandel; Preis: Euro 9,90
Es gibt sie doch, die ungarischen Krimis – und es gibt auch Verleger, die sie publizieren, spannende Unterhaltung für Jugendliche ab 15 und Erwachsene: Ein Mystery-Krimi, wie es in der Verlagsankündigung heißt: Wirklichkeit und Übersinnliches, Gruseliges, Geheimnisvolles und auch Romantik verweben sich hier zu einem dichten Netz.
Der Roman fängt ganz sachte an, die Erzählerin, eine junge Frau; Pamela Taylor, genannt Pam, Biologin in einem Institutsteam, hat eine Schwäche für die 60er Jahre ihrer Eltern und für Versteigerungen, bei denen sie für wenig Geld bereits die schönsten Dinge ergattern konnte. Doch schon sehr bald geht es rasant weiter, komische Zufälle, Skulpturen mit besonderen Fähigkeiten, Entführung, Verfolgungsjagd, Mord.
Das Tempo steigert sich bis zum Schluss und lässt den Leser erst nach der 364. Seite wieder zu sich kommen. Vorausgesetzt, er mag diese Art von Romanen, die nicht von Blut und Grausamkeit triefen, bei denen man mitdenken und genau aufpassen muss, um keinen der vielen ausgelegten Fäden zu verlieren – die zum Schluss zusammenlaufen.
Weiler greift in der ungarischen Geschichte bis ins Jahr 1942 zurück, verweilt ausgiebig in den Jahren 1988/89, als der große ungarische Exilschriftsteller Sándor Márai sich das Leben nahm. Dazwischen immer wieder Rückblenden in die 60er Jahre. Der eigentliche Roman spielt im Winter des Jahres 2010 an 12 Tagen in San Diego und Philadelphia. Reizvoll, wie viel Lokalkolorit der Autor mit hineinschreibt.
Als Schüler und später als Stipendiat hat er in beiden Städten gelebt, kennt sich aus und besucht mit seinen Protagonisten und uns Lesern vertraute Straßen, imposante und berühmte Gebäude: Bei einer sonntäglichen Auktion ersteigert ein unbekannter älterer Herr in San Diego ein Brautkleid und eine Remington-Skulptur. Das Anwesen gehörte der bekannten, reichen italienischen Familie Fibione. Vom Sohn der Familie ist nichts mehr bekannt. Pam lässt sich mitreißen und ersteigert – ohne dass sie richtig nachvollziehen kann, wie es dazu kam – einen stahlblauen Catalina Pontiac aus dem Jahr 1960. Obwohl sie sich damit einen Herzenswunsch erfüllt hat, kommt keine Freude in ihr auf, sie fährt in ihrem alten Auto nach Hause und lässt sich den Pontiac später bringen. Am nächsten Tag beginnen „Zufälle“ und Ungereimtheiten: Als sie sich mit ihrem Freund Paul, einem Medizinstudenten treffen will, hat ihr Pontiac unterwegs einen Platten. Mit Gewalt gelingt es Paul und ihr, den Kofferraum zu öffnen. Neben einem fast untauglichen Reifen findet Pam eine Hornbrille und einen Brief in einer silbernen Schatulle. Handschriftlich warnt die vormalige Besitzerin, Marianne Fibione, vor dem Wagen, der schon einmal das Glück einer Familie zerstört habe. Pam wird ohnmächtig und findet sich in Pauls Studentenbude wieder, die er sich mit einem Kommilitonen, dem Literaturstudenten George Wahloczky, teilt. Dieser bringt die junge Frau nach Hause, während Paul seine Vorlesungen besucht. Später erzählt Paul seiner Freundin, dass er bereits in der Bibliothek anhand von Zeitungsartikeln recherchiert hat, was es mit dem Pontiac auf sich haben könnte: Mit dem Auto wurde 1964 vor dem Eingang zu Disneyland ein tödlicher Unfall verursacht. Pam hat plötzlich Angst, trotzdem packt sie die Neugier. Die Beiden finden neue Einzelheiten: Der siebzehnjährige Sohn Max Fibione hat einen Familienvater erfasst und danach Fahrerflucht begangen. Seit dem hat niemand mehr von ihm gehört. In der gleichen Zeitung entdeckt Pam die Fotografie einer Statue, die damals für einige hunderttausend Dollar versteigert worden war. Pam erkennt in ihr den Indianer auf dem springenden Pferd, die Skulptur, die im Haus Fibione unter den Hammer kam – allerdings für nur 200 Dollar. Zum ersten Mal spitzen sich die Ereignisse zu, als Pam im Sand am Strand vom Pfeil der Indianerstatue tief in den Rücken gestochen wird. Sie ist total verstört, fährt nach Hause, wo sie die Figur wieder zu sehen glaubt. Sie ist überzeugt, Paul hat sich einen üblen Scherz mit ihr erlaubt. Ja, sie hetzt sogar die Polizei auf ihn.
Das Netz schlingt sich enger um Pam. Sie glaubt Paul nicht, der inzwischen weiter über den Cheyenne recherchiert und herausgefunden hatte, dass zwei Statuen, die einzigen der vielen Reproduktionen, die sich völlig gleichen, in keinem Museum aufzufinden sind. Pamela wird inzwischen von George und seinem einarmigen Freund entführt, kann aber in Philadelphia entkommen. Ein Arzt, ein bekannter Herzspezialist rettet und behandelt sie – doch nachts Pamela wird abermals entführt. Dieser Arzt verlor als kleiner Junge seinen Vater bei einem Verkehrsunfall, den der Fahrer eines stahlblauen Pontiac verursacht hatte und dann Fahrerflucht beging. Paul recherchiert indessen, versucht seine Freundin auf eigene Faust zu finden; denn ihm ist klar geworden, dass sowohl der Pontiac, als auch die Figur mit ihrem Verschwinden zu tun haben müssen.
Eine Spur führt ihn nach Philadelphia zu verschiedenen Plätzen und Gebäuden, auch ins Mütter Museum, das eine anatomische Sammlung abnormer Verstorbener beherbergt. Dazwischen erzählt uns Weiler die abenteuerliche Geschichte der Skulpturen und ihrer Besitzer. Ihr Besitz, ihre „Fähigkeiten“ sind es, die alle Protagonisten miteinander verknüpfen. Pam wird zu einer Gesellschaft gebracht, zu der nur Menschen mit ungewöhnlichen Lebensgeschichten Zugang bekommen. Eigentlich geht es aber darum, die zwei völlig identischen Remington-Cheyennes zusammenzubringen, von denen die eine Skulptur Glück, die andere Unglück bringen soll.
Spannend, die Legenden um die unzähligen Remington-Cheyennes, von denen eben nur die Nummer sieben und die Nummer siebzehn identisch sind. Pam wird natürlich in letzter Minute gerettet – sonst hätte sie die Geschichte nicht erzählen können.
Die detaillierten und kenntnisreichen Erzählungen hinter der mitreißenden Story machen das Buch so interessant. Es tauchen bekannte historische Persönlichkeiten auf wie Márai und Poe, Walt Disney, Remington, der Forscher Mütter mit seinem Museum in Philadelphia und andere. Auch bekannte Gebäude können wir bewundern und besuchen.
Der Schluss ist vielleicht ein bisschen zu übersinnlich und verworren, soll aber zeigen, dass Glück und Unglück sehr nahe beieinander liegen und sich für oder gegen die gleiche Person wenden kann. Gibt es Menschen, die mit einem Glücksstern geboren werden, die der „Zufall“ immer wieder auf die richtige Bahn lenkt, denen scheinbar alles mühelos gelingt – und gibt es Menschen, die mit einer Pechsträhne auf die Welt kommen und mit ihrem Bemühen immer scheitern? Oder haben die einen nur einfach Glück, weil sie an sich glauben und die anderen Pech, weil sie immer schon ein Unheil nahen sehen, oder zu gierig sind nach Glück, Reichtum und Macht? Darauf gibt der Autor allerdings keine Antwort – das ist auch nicht wichtig. Alle „Zufälle“ führen schließlich zusammen, wie in einem Drehbuch vorhergeplant, obwohl die Akteure keine Ahnung davon haben. Sie werden immer wieder vom Hauch der Mystik und der Magie gestreift – oder bilden sich das ein.

